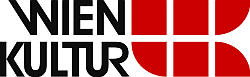Der ÖSTERREICHISCHE KOMPONISTENBUND (ÖKB) und die MDW – UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST WIEN luden Anfang April zum AUSTRIAN FILM MUSIC DAY (dem Fachtag der österreichischen Film- und Medienmusikbranche), in dessen Rahmen zahlreiche Vorträge stattfanden. Alle davon waren interessant, einer allerdings war für junge Komponistinnen und Komponisten von besonderem Nutzen: BERND JUNGMAIR, selbst Komponist und Geschäftsführer der COSMIX STUDIOS, sprach übers Geld.
Dass jemand über Geld redet, ist in der Welt der Werbekomposition mehr als ungewöhnlich. Ein Grund mehr, bei Bernd Jungmairs Vortrag zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Werbefilmkomposition genauer hinzuhören. Eine Zusammenfassung für all jene, die immer schon wissen wollten, wie viel Geld man für Kompositionen für Film und Fernsehen verlangen kann.
Die Fragen „Wie kann man als Auftragskomponist überleben?“ und „Wie kommt man zu Geld?“ seien die ersten, die man sich stelle, wenn man am Beginn seiner Karriere stehe. Er selbst, erzählte Jungmair, habe früh mit Bands sein Glück versucht, wisse also nur zu gut, wie es sei, sich von einem Konzert zum nächsten zu hanteln und nicht zu wissen, wie man die nächste Miete zahlen solle. Sein Leben als Musiker habe er im Wesentlichen aus Auftrittshonoraren und den Tantiemen, die AKM, AUME und LSG ausbezahlt hätten, bestritten. Dann aber sei noch ein weiteres Mittel dazugekommen: der Rechteverkauf.
Mit einem eingespielten Spot, für den er die Musik gemacht hat, veranschaulichte er sodann „die enormen Mittel und den Wahnwitz, den die Werbung bereithält“. Konkret ging es um einen Spot für eine arabische Vereinigung von Ölherstellern, die gleichzeitig Sponsor für Real Madrid war. Mit sechzig Sekunden sei der Spot überlang gewesen, Spots solcher Länge würden aus Kostengründen nur noch selten hergestellt. Den Orchestersound dafür habe er mit der Vienna Symphonic Library erstellt, berichtete Jungmair. Der Spot allerdings, obwohl außergewöhnlich kostenintensiv produziert, sei nie gesendet worden. Der Grund sei gewesen, dass das dafür verantwortliche Vorstandsmitglied der Vereinigung – und mit ihm all seine Ideen – gegangen worden sei. Der Spot, so führte Jungmair aus, zeige sehr gut, in welchem Umfang Werbung passieren könne. Millionen seien dafür aufgewandt worden, und wofür?
Gleich darauf kam Jungmair auf den ewigen Widerspruch, den der Beruf der Werbefilmkomponistin bzw. Werbefilmkomponisten mit sich bringt, zu sprechen: Einerseits sei es immer noch ein wenig verpönt, als Komponistin bzw. Komponist für die Werbung zu arbeiten. Gleichzeitig sei die Werbung der einzige Bereich, in dem man „normales Geld“ für seine Arbeit bekomme. Das Livegeschäft, der CD-Verkauf – das alles sei heute doch zu vernachlässigen. Plattenverträge seien ein Witz. „Was bleibt? Die Werbung.“
Ein Problem hier sei aber die Verschwiegenheit, was übliche Honorare betreffe, legte Jungmair dar. „Frage einen Kollegen, was er für eine bestimmte Werbung in Rechnung stellt, und er wird zu 99 Prozent antworten, dass er darüber nicht sprechen darf. Wie aber sollen dann junge Kollegen wissen, was ihre Arbeit wert ist?“ Die Konsequenz dessen sei, dass sich viele unter Wert verkaufen, was nicht nur für sie selbst, sondern für die gesamte Branche schlecht sei. 2.000 Euro für eine kleine Komposition klängen oft viel, „aber nur dann, wenn man nicht weiß, dass genau 15.000 Euro dafür branchenüblich sind.“
Wie viel für Onlinewerbung? Wie viel für Audio-Branding?
Problematisch seien natürlich immer noch die aufgrund der Finanzkrise in den Keller gefallenen Tarife, die sich nur teilweise erholt hätten. So hätten sich zwar die Agenturtarife erholt, jene für die DienstleisterInnen noch nicht. Neulich habe er einen Etat gesehen, der schon zu zwei Drittel für den Onlinebereich ausgeschrieben worden sei. Nur noch ein Drittel sei also für klassische Werbeformate wie Radio und Fernsehen vorgesehen gewesen. Hier, so Jungmair, stelle sich die Frage, wie viel man für den Onlinebereich überhaupt verrechnen solle. Im Fernsehen bekomme man für jedes Ausstrahlungsland Geld. „Wie ist das nun im Onlinebereich? Online ist ein Spot ja theoretisch weltweit abrufbar.“
„Warum macht eine Firma wie Gazprom überhaupt Werbung, fragt man sich“, so Jungmair. Als Kundin bzw. Kunde könne man doch ohnehin nicht entscheiden, von welcher Firma man das Gas beziehen wolle. Nur Gas von Gazprom zu beziehen, das sei ja unmöglich. Es gehe also zu 100 Prozent um das Image. Das aber werde gepflegt. So ein Gazprom-Spot laufe mitunter mehrfach bei jedem Champions-League-Spiel und die wenigsten MusikerInnen und KomponistInnen wüssten, „dass sie jedes Mal daran verdienen können, wenn er denn läuft.“
Was auch die wenigsten wüssten, sei der Umstand, dass Audio-Branding – darunter versteht man das mit Musik unterlegte Firmenlogo am Schluss eines Spots – völlig gesondert und vor allem mit einem wesentlich höheren Betrag abzurechnen ist, „weil es dabei um den Kern der Marke geht“. Während also die meisten KomponistInnen (nur) die Entgeltlichkeit eines Jingles auf der Rechnung hätten, werde oft für das Audio-Branding nichts verrechnet. Das aber sei ein schwerer Fehler. Man könne und müsse hier zwei Rechnungen bzw. eine Rechnung für zwei Positionen stellen. Für dieses Audio-Branding werde seitens der Unternehmen in der Regel auch markenrechtlicher Schutz beantragt. Daraus wiederum ergebe sich eine Wertsteigerung für die Marke selbst. Denn: „Je mehr Rechte eingetragen sind, desto wertvoller ist eine Marke auch.“ Ergo: Die Trennung zwischen Spot und Audio-Branding sei unbedingt erforderlich. Das viel Wertvollere sei das Audio-Branding.
Jungmair präsentierte einen Kostenvoranschlag für Jingles (Eine genau Auflistung der Sätze findet sich auf der Webseite des ÖKB). Für Audio-Branding könne bis zum Sechsfachen des Preises verrechnet werden. Davon gebe es natürlich Abstriche, wenn das Gesamtbudget etwa sehr niedrig sei. In etwa könne man, so Jungmair, davon ausgehen, dass eine bekannte Sängerin zwischen 5 und 10 Prozent des Gesamtbudgets bekomme, aber nur zwischen 2 bis 3 Prozent auf die Komponistin bzw. den Komponisten entfielen. Wenn das Gesamtbudget daher nur 150.000 Euro ausmache, könne man (wie im Kostenvoranschlag veranschlagt) nicht 15.000 Euro verlangen. Wenn das Gesamtbudget bei zwei oder drei Millionen Euro liege, könne man entsprechend mehr verlangen.
Aus dem Publikum wollte jemand wissen, wie man an diese Zahlen herankomme. Die Antwort von Jungmair: „Fragen!“ Es sei nicht unhöflich, nach der genauen Höhe des Budgets zu fragen. Im Gegenteil, es sei professionell und werde auch so ausgelegt, wenn man sich eingangs nach dem Budget erkundige, um dementsprechend kalkulieren zu können.
Darüber hinaus sei es das Um und Auf, an die Schaltpläne zu kommen bzw. über die genauen Schaltungen Bescheid zu wissen. Das könne die Tantiemenausschüttung im Einzelfall verzehnfachen.
Eine weitere Frage aus dem Publikum: „Gibt es Partnerschaften zu Musikverlagen?“ Komischerweise sei diesbezüglich noch nie jemand an sie herangetreten, antwortete Jungmair. Eine Partnerschaft bestünde allerdings, was die Rechteklärung betreffe. Oft gelte es nämlich, ganz schnell die Rechte Dritter abzuklären. Dafür habe man nicht sechs Wochen Zeit, das müsse in der Regel binnen 24 Stunden passieren. Sollten sich in dieser Zeitspanne die Rechte Dritter nicht abklären lassen, müsse man sich anders entscheiden, also umdisponieren, was das Fremdmaterial anbelange.
Zum Abschluss richtete Jungmair noch einen Appell an die jungen KomponistInnen, sich nicht mit zu wenig Honorar zufrieden zu geben, sondern anzuerkennen, dass das, was sie machen, einen hohen Wert hat und sie dafür – zumindest in der Werbung – auch gutes Geld verlangen können.
Markus Deisenberger
Weiterführende Informationen
COSMIX STUDIOS
Austrian Film Music Day
Österreichischer Komponistenbund (ÖKB)
Danke
Dieser Beitrag wurde von der Kulturabteilung der Stadt Wien (MA 7) gefördert.