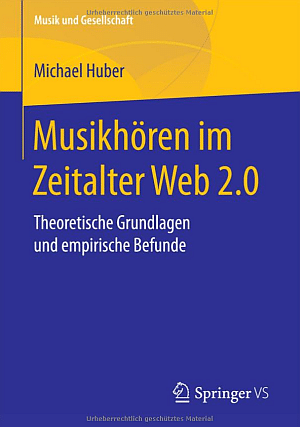MICHAEL HUBERS aktuelles Buch „Musikhören im Zeitalter Web 2.0“ beschäftigt sich mit den geänderten Rahmenbedingungen des Musikhörens. Im Gespräch mit Markus Deisenberger erklärte der Autor und Musiksoziologe, wer am Streaming wirklich verdient. Außerdem sprach er über Social-Media-Stars und ihre konventionellen Karrieren und über Musik als Tool, mit dem sich gut kommunizieren lässt.
Im Jahr 2016 hat Streaming zum ersten Mal den Download abgehängt. Welche Konsequenzen hat das?
Michael Huber: Das hat die Konsequenz, dass sehr viele Musikhörerinnen und Musikhörer von den Varianten des Hörens weggehen, die den Musikerinnen und Musikern Geld bringen.
Die Statistik besagt nun, dass der Musikmarkt wegen der Streamingdienste im vergangenen Jahr in Deutschland um 4,2 Prozent gewachsen ist. Dieses Wachstum wird auf Basis der Umsätze der Labels ermittelt. Wenn aber zeitgleich die Einnahmen der Künstlerinnen und Künstler sinken, wie es weiter in der Statistik heißt, muss das bedeuten, dass beim „Middleman“ mehr hängen bleibt. Profiteure der wachsenden Einnahmen durch Streaming sind also die Plattenfirmen. Warum ist das so und was muss geschehen, dass endlich bei den Urheberinnen und Urhebern mehr hängen bleibt?
Michael Huber: Ich will jetzt hier kein Major-Bashing betreiben, aber wenn man sich den geleakten Vertrag zwischen Spotify und Sony ansieht, hat die Tonträgerindustrie insofern aus dem Desaster mit den Downloads und Napster gelernt, als sie bei Streaming von vorneherein darauf geachtet hat, wie man zentrale Machtpositionen besetzen kann und was man tun muss, damit man nicht überbleibt. Und das haben sie sehr gut gemacht, indem sie sich bei den Streaming-Firmen eingekauft haben. Man weiß es natürlich nur von Spotify, aber sehr wahrscheinlich ist es bei anderen Anbietern nicht unähnlich. Da Spotify unter dem Strich immer noch rote Zahlen macht, sind die einzigen, die von den steigenden Umsätzen profitiert haben, die Tonträgerfirmen. Indem sie die Musik zu ihren Bedingungen lizenzieren, gibt es für die Streaming-Plattformen nur zwei Möglichkeiten: Entweder man gibt die hohen Preise, die man zahlt, an die Konsumentinnen und Konsumenten weiter. Aber dann kauft kein Mensch mehr ein Abo, weil das einfach zu teuer wird. Oder man bleibt bei den billigen Preisen und steigt deshalb mit Verlust aus. Pest oder Cholera also. Ich kann es mir aussuchen. Im Moment ist es noch so, dass Streaming-Abos relativ billig sind, weil es wenige sind, die die Abo-Variante wählen. Das heißt, der billige Preis soll einen Anreiz dafür darstellen, ein Abo abzuschließen. Aber es geht sich einfach nicht aus, weil die Rechtehalter, die Labels also, den möglichen Gewinn a priori abschöpfen. Spotify hätte sich damals dagegen wehren können, aber anfangs brauchte man halt Risikokapital. Die großen Labels hatten damals noch genug Kapital im Hintergrund, schließlich sind das Weltkonzerne, die sich da eingekauft haben. Man kann nur hoffen, dass diese Verträge irgendwann auslaufen und neu verhandelt werden müssen.
Für die Durchschnittskonsumentinnen und -konsumenten ist nur schwer verständlich, dass eine Firma wie Spotify rote Zahlen schreibt. Ebenso unverständlich ist, dass von dem Beitrag, den sie leisten, eigentlich so gut wie nicht bei den Künstlerinnen und Künstlern ankommt.
Michael Huber: Sie müssen das ja auch nicht verstehen. Das ist nicht Job der Konsumentinnen und Konsumenten, das zu durchschauen.
„Seit das Urheberrecht völlig zahnlos und nicht mehr exekutierbar ist, hat sich das Angebot potenziert.“
Aber was kann die Konsumentin bzw. der Konsument tun?
Michael Huber: Vinylschallplatten kaufen und auf Konzerte gehen. Die IFPI präsentiert seit Jahren Consumer Reports, die belegen, dass man die Generation Download vergessen kann. Aber die Jüngeren verstehen wieder, dass es notwendig ist, die Musikschaffenden zu unterstützen, indem man auf eine Weise konsumiert, bei der auch etwas bei der Urheberin bzw. beim Urheber ankommt. Die ganz Jungen, die ich in meiner Studie nicht mehr erfasst habe, die 13- bis 15-Jährigen also, sind eher bereit, etwas zu bezahlen. Die kaufen sogar Vinyl, obwohl sie vielfach noch gar keinen Plattenspieler besitzen. Da ist eher das Problembewusstsein vorhanden, dass irgendwann einmal keine Musik mehr produziert wird, wenn bei den Künstlerinnen und Künstlern nichts ankommt.
Aber das Skurrile ist ja: Die Verwertungsgesellschaften behaupten seit Jahrzehnten, dass es, sollte das Urheberrecht aufgeweicht werden, zu einem massiven Künstlersterben kommen wird. Das Gegenteil aber ist der Fall: Seit das Urheberrecht völlig zahnlos und nicht mehr exekutierbar ist, hat sich das Angebot potenziert. So viel billige und gut aufbereitete Musik wie heute war noch nie verfügbar. Wir haben ein Überangebot. Daher geht das Argument, irgendwann hätten wir keine Musik mehr, völlig ins Leere. Viele wären froh, wenn es weniger gäbe. Dann wären sie mit dem Angebot nicht so restlos überfordert.
Diese Übersättigung beschreibt Clara Luzia in dem von Ihnen gebrachten Zitat sehr gut – eine Überforderung, die in eine mangelnde Bereitschaft mündet, sich auch nur irgendetwas länger als ein paar Sekunden anzuhören. Als Kontrast: In ihrem Buch „Bedsit Disco Queen“ beschreibt Tracy Thorn, wie sie die erste Platte ihrer Band auf dem Versandweg anbot. Per Kleinanzeige. Das heißt, die Leute mussten vorweg Geld überweisen für eine Platte von einer Band, die sie nicht kannten, und für Musik, die sie nicht kannten und die man sich auch nirgends anhören konnte. Und? Es hat funktioniert. Binnen weniger Tage wurden einige Hundert Stück geordert. Aus heutiger Sicht klingt das wie ein Märchen aus grauer Vorzeit. Denken Sie, dass der Rückgang an Begeisterungsfähigkeit angesichts des Überangebots reversibel ist?
Michael Huber: Ich glaube, dass die junge Generation besser damit umgehen wird können. Aber Sie und ich, die wir in einer Mangelsituation aufgewachsen sind, packen das nicht, dass es plötzlich keinen Mangel mehr, sondern ein Überangebot gibt. Ich kann mich erinnern, dass ich mich, als Madonna anfing irrelevant zu werden, jedes Mal gefreut habe, ihr neues Album nicht kaufen zu müssen. Wann soll ich mir die Platte auch anhören? Ich habe eh schon zwanzig ungeöffnete Alben herumstehen, die ich mir noch anhören muss. Für die Jungen heute aber ist diese Idee, dass man sich Musik anhören muss, nicht einmal mehr skurril. Sie ist einfach nicht vorhanden. Wir sind mit der Idee aufgewachsen, dass es einen Wert hat, bestimmte Musik zu hören. Das ist doch kein Thema mehr. Musik ist wie Wasser, das aus einer Leitung rinnt, wie Luft, die man atmen kann. „Music like water”, wie es Gerd Leonhard vor zehn Jahren formulierte. Da sind wir heute angelangt. Erst wenn das nicht mehr so wäre, dass ich mit einem Handgriff zum Handy jede nur erdenkliche Musik abrufen und hören kann, wäre es anders. Ich bin kein Prophet, aber im Moment schaut es so aus, als würde alles, was früher aufgrund der Verknappungspolitik der Tonträgerindustrie unter der Decke blieb, aufgearbeitet. Es wird dokumentiert und jede noch so kleine Nische wird beleuchtet. Wenn man so will, wird gerade die musikalische Landkarte gezeichnet, bis irgendwann wirklich alles erfasst ist. Man geht auf Discogs, sucht es im Original oder irgendwelche Freaks bringen Reissues raus. Jede noch so obskure Geschichte wird wieder aufgelegt – in 180-Gramm-Pressung mit Booklet. Und irgendwann ist dann auch dieser Markt gesättigt. Die Nachfrage wird durch das Angebot befeuert. Nur irgendwann wird das Nachfragehoch auch abebben. Was dann passiert, weiß ich nicht.
„Ich tue mir ja nichts Schlechtes, wenn ich eine Entdeckung, die ich gemacht habe, sofort kommuniziere und dadurch zumindest kurzfristig einen Distinktionsgewinn verbuchen kann.“
In meiner Jugend war Musik ein soziales Thema, weil man sich durch Geschmack stark abgrenzte. Musik sei wieder mehr zum sozialen Thema geworden, schreiben Sie im Buch. Damit ist aber sicher etwas anderes gemeint, oder?
Michael Huber: Ja. Bei uns konnte Abgrenzung über Zugehörigkeit und Fantum passieren, weil es überschaubar war. Da gab es fünf, sechs Alternativen und da war man zugeordnet. Wenn nicht, dann war mal eine bzw. einer von denen, die der Medienwissenschaftler Neumann-Braun als „allgemein Jugendkulturorientierte“ bezeichnet, die sogenannten Mitläuferinnen und Mitläufer also. Aber die Opinionleader waren damals eindeutig zugeordnet. Das gibt es nicht mehr, seit die Situation völlig unüberschaubar geworden ist. Dadurch ist es beliebig geworden und nicht mehr notwendig, weil die Abgrenzungen nicht mehr über Musik, sondern über Computerspiele oder anderes erfolgen. Aber Musik ist wieder mehr ein soziales Thema geworden, weil Musik jetzt von den Jungen als Tool verwendet wird. Es ist leicht, über Musik zu kommunizieren. Geheimwissen und Informationsvorsprung sind eine schwache Währung geworden, weil das Wissen ja mit Handy via Wikipedia in Minutenschnelle aufholbar ist. Ich tue mir ja nichts Schlechtes, wenn ich eine Entdeckung, die ich gemacht habe, sofort kommuniziere und dadurch zumindest kurzfristig einen Distinktionsgewinn verbuchen kann. Wenn man zu unserer Zeit eine seltene Platte hatte, dann musste jemand schon ein sehr guter Freund sein, um die auf Kassette überspielt zu bekommen. Das war eine Auszeichnung für die besten Freundinnen und Freunde. Diese Auszeichnungsmöglichkeit ist weggefallen, die Exklusivität über Musikwissen und Musikbesitz ist nicht mehr herstellbar. Information und Musik sind frei. Dadurch, dass Musik frei ist, ist sie ein Tool, über das ich via soziale Medien gut kommunizieren kann. Musik ist ein Gebrauchsgut geworden. Dass man das Cover anschaut, die Texte studiert, machen nur noch „Gestörte” wie Sie und ich.
Plattformen wie Musical.ly spülen plötzlich Leute hoch, die an der Musik anderer partizipieren …
Michael Huber: Ja, aber auch das mündet zumindest im Spitzenfeld in konventionelle Karrieren. Die Nummer eins, ein US-amerikanischer Interpret, dessen Name mir entfallen ist, ist über Musical.ly groß geworden, indem er Justin-Bieber-Songs nachgesungen hat. Er hat aber dann den Sprung zu einer eigenen Musikkarriere geschafft – durchaus vergleichbar mit der Karriere, die man früher über Castingshows machte. Jetzt sind es halt Leute, die auf sozialen Medien eine gewisse Aufmerksamkeit erreichen, dann von der alten Industrie entdeckt und gekauft werden. Darauf wird dann eine relativ konventionelle Karriere aufgebaut. In den Köpfen ist also immer noch das alte Modell drin. Er zieht mit seinen „eigenen” Songs, das heißt mit für ihn geschriebenen Songs, von Bühne zu Bühne. Damit lässt sich noch Geld verdienen. Mit einem Unterschied: Die Gatekeeper sind nicht die, die in der Jury sitzen, sondern die Konsumentinnen und Konsumenten im Netz, die das entweder gut oder nicht gut finden. Nur wenn jemand wirklich viele Follower hat, investiert die Industrie entsprechendes Risikokapital.
Eine Erkenntnis Ihrer Studie ist: Die unter 20-Jährigen hören zwar mehr Musik als die Älteren, aber sie pflegen einen äußerst pragmatischen Zugang zur Musik, das heißt, es gibt eigentlich kein absichtsloses Hören mehr. Musik hört man, um zu entspannen, um sich in Stimmung zu bringen, um jemanden anderen zu beeindrucken etc. Kann man diese Entwicklung mit der im Bildungsbereich viel gescholtenen Kompetenzorientierung vergleichen?
Michael Huber: Das Bildungssystem hat völlig den Anschluss verloren. In der Bildung wird immer noch so getan, als wären Leute wie Konrad Paul Liessmann diejenigen, die sagen, was passiert. Die Jugendlichen leben in einer Welt, die damit nichts zu tun hat. Denen ist kulturelle Bildung so etwas von egal. Musik ist für die kein Bildungsthema, das man sich aneignet und über das man Distinktion und Reputation gewinnen kann, sondern ein Tool, das man verwendet, das man je nach Stimmung dazu verwendet, um seine Lebenssituation zu optimieren, um es einem angenehmer zu machen. Das Lieblingswort ist „Chillen“. Wenn ich zur Musik chillen kann, ist viel gewonnen. Zu wissen, welche Musik das ist, ist nebensächlich. Da genügen oft auch zwanzig Sekunden, und die Playlist besteht dann oft aus wild zusammengewürfelten Dingen, von denen wir nie auf die Idee kämen, sie in eine Compilation zu geben. Das hat andere Bedeutungen und Querbezüge.
In einem Punkt werden Sie dennoch mit Liessmann übereinstimmen, denke ich. Wenn er sagt, dass es schwachsinnig ist, in einer Digitalisierungsoffensive großen Unternehmen wie Apple das Geld nachzuwerfen, wo die meisten Studien doch ganz eindeutig sagen, dass die Verwendung von iPads gar nichts zur Verbesserung der Bildungssituation beitragen wird …
Michael Huber: Ja. Das sind Sachen, die ich in der Schule nicht vermitteln kann. Alle wissen, dass etwas, wenn man motiviert ist und es gern und freiwillig macht, von der Wirkung her viel nachhaltiger sein wird, als wenn es einem vorgesetzt wird. Das, was die Jungen in puncto Medien zu Hause sowieso machen, ist daher viel nachhaltiger und wirksamer. Ihnen den Umgang mit neuen Medien beibringen zu wollen, ist geradezu lächerlich. Viele von diesen Schülerinnen und Schülern sind im Umgang mit neuen Medien kompetenter als die Lehrkräfte, die ihnen diesen Umgang beibringen wollen.
„Es wird immer diejenigen geben, die in der Volksschule Geige spielen und sehen, wie die Eltern in die Oper gehen.“
Könnte man sagen, dass das den Abschied von der Bildungsbürgerlichkeit, wie wir sie kennen, bedeutet?
Michael Huber: Das kommt darauf an. Eine Kernaussage meines Buches ist, dass man nie verallgemeinern kann, weil es immer unterschiedliche Typen gibt. Es wird immer Bildungshörerinnen und -hörer geben, für die Musik einen Wert per se hat. Eine zentrale Frage in meinem Buch ist es ja auch, ob der wichtige Einfluss der musikalischen Sozialisation durch das Elternhaus durch die Möglichkeiten des Internets völlig aufgeweicht wird. Nein, wird er nicht. Denn bis die Jugendlichen mit den Technologien in Berührung kommen, ist ja schon einiges passiert, ist eine Basis gelegt worden, die eine grundlegende Haltung zur Musik begründet. Auf diese grundlegende Haltung kommt es an. Insofern ist unser Schulsystem eines, das Ungleichheit fördert, weil die Kinder mit ungleichen Grundbedingungen kommen und dann mit der Gießkanne gleich gefördert werden. Um beim Bild zu bleiben: Da gibt es Kinder, die auf Wüstenboden wachsen, und solche, die auf Humus wachsen, und beide gießt man gleich stark. Es wird also nie aussterben, dass es Musikbegeisterte gibt. Es wird immer diejenigen geben, die daran glauben, dass Musik und das Wissen um Musik zu einem guten, kultivierten Leben gehören.
Es wird immer diejenigen geben, die in der Volksschule Geige spielen und sehen, wie die Eltern in die Oper gehen. Denen steht aber eine große Masse gegenüber, für die Musik etwas ist wie Wasser, das aus einem Wasserhahn kommt. Und so lange Wasser rauskommt, mache ich mir keine weiteren Gedanken über das Wie und das Warum. Und da hat sich viel verschoben: Für diese große Masse gibt es eine neue Quelle, und zwar das Internet. Vorher hatten sie das Radio und Fernsehen. Die Generation, die sich auf Radio und Fernsehen als Musikquelle verlässt, wird langsam aussterben. Das Problem am Internet nun ist, dass es im Gegensatz zu Funk und Fernsehen nicht kuratiert ist und wenig Qualitätskontrolle hat. Genau das auch ist der Unterschied zwischen Wikipedia und der Encyclopedia Britannica. Bei Letzterer gibt es jemanden, der das gut findet und mit seinem Namen dafür einsteht, dass das, was drinnen steht, in Ordnung ist. Bei Wikipedia können alle reinschreiben, was sie mögen, und Leute, die nicht gelernt haben, damit umzugehen, glauben das unter Umständen. Die Gedanken- und Anspruchslosen sind mit einem Überangebot an Information konfrontiert und rezipieren das so, wie es bequem für sie ist.
Die meisten hören also absichtslos, pragmatisch, nicht kuratiert und leben in ihrer Blase. Wenn ich hauptsächlich mobil, also unterwegs und mit Kopfhörer höre, wie Ihre Studie belegt, fällt auch noch das häusliche Korrektiv weg. Was ist die Konsequenz, was die Gefahr dessen?
Michael Huber: Gefahr war es immer für diejenigen, die glauben, sie müssen etwas festsetzen, bestimmen und verteidigen. Und für diejenigen, die versuchen, ihre Werte an die nächste Generation weiterzugeben. Nach dem Motto: Die Kinder dürfen nur das hören, was der Vater für gut befunden hat. Und diejenigen, die Geld damit verdienten, dass sie das Angebot eingegrenzt haben. Die Tonträgerindustrie also. Für beide sieht es schlecht aus, weil sich die Jugend informiert, wie sie es will, und hört, was sie will. Ob das eine Gefahr ist? Bis jetzt gab es bei jeder neuen Technologieentwicklung die Kulturpessimistinnen und -pessimisten, die den Untergang des Abendlandes witterten. Das Internet ist keine Gefahr für die Jugend, sondern für diejenigen, die nicht gelernt haben, damit umzugehen. Die Frage ist, ob wir uns nicht von gewissen Werthaltungen verabschieden müssen und sich nicht für die Schule und die Kulturpolitik ein Auftrag ergibt, die Hörerinnen und Hörer auf die Freiheitssituation und das Angebot vorzubereiten, indem wir sorgsam kuratierte Angebot unterbreiten.
Wie soll das aussehen?
Michael Huber: In der Podiumsdiskussion jüngst hat ein Schüler das Dilemma so schön mit den Worten zusammengefasst: „Es gibt sehr viel Musik, über die ich sehr viel weiß und die mir nichts bedeutet.“ Wieso? Man füllt ihn offenbar mit sinnlosem Musikwissen an. Ich sehe es doch bei meiner Tochter. Was hat sie im Musikunterreicht gelernt? Die Lieblingsspeisen von Beethoven. Da glaubt man, indem man etwas kindgerecht aufarbeitet, könne man die gewünschten Inhalte vermitteln. Das ist schlicht und ergreifend Unsinn. Entscheidend wäre, dass jemand, der die mittlere Reife hat, einen Bach von einem Beethoven und einem Mozart unterscheiden kann. Das bringe ich aber nicht durch Wissen und Wissensfülle bei. Wann er gelebt und was er gern gegessen hat, ist dafür unerheblich. Es geht darum, die Musik erlebbar zu machen. Darum geht es. Etwas nachvollziehbar machen und eine Haltung und eine Wertschätzung möglich zu machen – das ist es, was zählt. Für viele Menschen ist es nicht nachvollziehbar, weshalb Mozart so gut und wichtig sein soll. Sie können es glauben, aber verstehen tun sie es nicht. Es wäre die Aufgabe der Musikerziehung, eine Beziehung aufzubauen und es nachvollziehbar machen. Erst dann sind die Komplexität und die Vielfalt verständlich. Aber die Vermittlung von Musikwissen ist irrelevant. Haltung, Erkenntnis und Verständnis sind wichtig. Die bekomme ich nicht durch Wissensvermittlung. Nie und nimmer.
Eine Erkenntnis der Studie ist, dass die Schere zwischen Alten und Jungen immer weiter aufgeht. Warum?
Michael Huber: Weil das Internet ein sehr schnelles Medium ist und viele Ältere das nicht mehr mitmachen können und es sie auch gar nicht mehr interessiert. Und weil natürlich auch sehr viel Unsinn verbreitet wird, ist auch eine gewisse Ablehnungshaltung da.
In Ihrer Studie trennen Sie in unterschiedliche Gruppen von Hörerinnen und Hörern, die Oldschool-Hörerinnen und -Hörer wie mich, denen Musik wichtig ist die gerne auf Konzerte gehen und sich auch entsprechend viele Tonträger kaufen, dann die Hörerinnen und Hörer 2.0, diejenigen, denen Musik gar nichts bedeutet und so fort.
Michael Huber: Die Musikbegeisterten sind 15 Prozent, ca. 18 Prozent ist Musik einfach unwichtig. Ungefähr so groß ist die Gruppe des Bildungsbürgertums, die Generation Web 2.0 nimmt circa ein Viertel ein. Und dann gibt es noch die Gruppe, die sich für Musik dann interessiert, wenn sie ins Gesellschaftsleben integriert ist, wenn sie an Werte gebunden ist. Beim Frühschoppen, bei der Blasmusik etc.
Wie strikt voneinander getrennt sind diese Gruppen?
Michael Huber: Nun, das ist bei diesen statistischen Methoden auf Basis der Antworten gut abtrennbar, aber es gibt immer Grauzonen und – das darf man auch nicht außer Acht lassen – biografische Entwicklungen. Ich sehe das bei mir. Es gibt Radiosender, die noch vor zehn Jahren unmöglich für mich waren, die ich mir jetzt aber anhören kann, wenn ich mich berieseln lassen will, aus nostalgischen Gründen oder weil es in meiner jetzigen Lebenssituation einfach passt. Ö3 hat mich über Eberhard Forcher erwischt. In „Solid Gold“ werden einfach Sachen wie die Talking Heads gespielt. Mit zunehmendem Alter kann sich die Haltung zur Musik also ändern. Es ändert sich ja auch die Intensität des Lebens.
Wenn man die Bedarfsorientierung, die man in anderen Bereichen wie der Bildung ernst zu nehmen scheint, auch im Förderwesen ernst nehmen würde, müsste man eigentlich eine breit angelegte Diskussion über Förderung anstoßen. Denn die Musik, die hauptsächlich gehört wird, ist eben nicht die klassische, die den Löwenanteil – etwa 95 Prozent – an Förderung verschlingt. Wie sehen Sie das?
Michael Huber: Kulturpolitik in Österreich wird fast ausschließlich für Touristinnen und Touristen sowie das Bildungsbürgertum gemacht. Im Sinne der Volkserziehung. Dafür wird Geld investiert, um die Österreicherinnen und Österreicher zu einem Kulturvolk zu machen. Das Ergebnis ist, dass dann Leute wie Gabalier Stadthallen und Stadien füllen. Viele Menschen fühlen sich von dem, was ihnen versucht wird näherzubringen, einfach nicht angesprochen. Wenn ein Platz in der Staatsoper mit 200 Euro subventioniert wird, hat niemand etwas dagegen, auch wenn die meisten Leute ihr Lebtag nie auf die Idee kommen würden, in die Oper zu gehen. Das wird als das offizielle Ding akzeptiert, mit dem das eigene Leben aber wenig bis gar nichts zu tun hat. Man darf auch nicht vergessen, dass 50 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher nie in ihrem Leben auf ein Konzert gehen. Nie. Musik ist für die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher das, was sie hören, wenn sie Fernseher oder Radio aufdrehen. Und wenn es nicht passt, dann wechseln sie den Sender.
Warum gibt es keinen Aufschrei? Weil es zu wenige interessiert und man sich mit der Gesamtsituation abgefunden hat, dass ein Großteil des Geldes in ein absolutes Minderheitenprogramm investiert wird?
Michael Huber: Erstens wissen das nur wenige. Und zweitens finden nach wie vor viele Menschen, dass Musik, die keine Kunst ist, auch nicht förderungswürdig ist, was eine Folge der jahrzehntelangen Politik ist. Kunst, das haben wir in der Schule gelernt, ist Mozart, Beethoven, Bach und Schubert, aber sicher kein Falco. Dieses Denken ist noch sehr stark in unseren Köpfen drin.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Markus Deisenberger
……………………………………………………………………………….
Prof. Dr. Michael Huber lehrt am Institut für Musiksoziologie der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien.
……………………………………………………………………………….