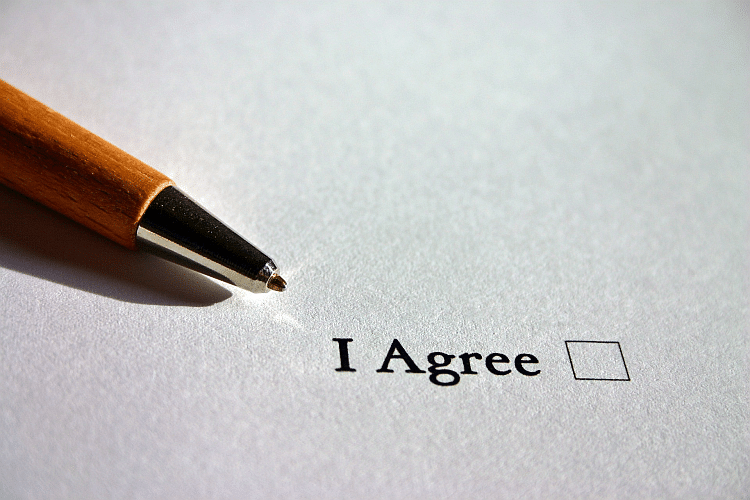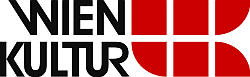Wenn sich junge MusikerInnen mit Labels und Verlagen an einen Tisch setzen, um ihre Zusammenarbeit vertraglich zu besiegeln, ist die Marktmacht meistens ungleich verteilt. Damit die Karriere nicht beendet ist, bevor sie überhaupt angefangen hat, gilt es einiges zu beachten. Von Markus Deisenberger.
Christiane Rösinger hat in ihrem Buch „Das schöne Leben“ mit einem einzigen Witz ganz gut zusammengefasst, wie es bei den meisten MusikerInnen finanziell aussieht:
Kommt eine Musikerin zum Arzt. Sagt der Arzt: „Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Sie haben nur noch zwei Wochen zu leben.“ Ruft die Musikerin erbost: „Und wovon bitte?“
Nur allzu gerne wird der erste Vertrag als die Möglichkeit gesehen, das Prekariat ein für allemal hinter sich zu lassen. Leider sieht die vertragliche Realität meistens anders aus. Und zwar so:
Punkt 1: Hochprozentiges?
Zuallererst geht es den meisten MusikerInnen um künstlerische Selbstverwirklichung. Seltsamerweise ist die erste Frage, liegt der Vertrag erst einmal auf dem Tisch, dann aber meistens die nach dem Geld. Dabei ist die Frage nach der prozentualen Beteiligung eine, die losgelöst für sich betrachtet herzlich wenig Aufschluss darüber gibt, ob ein Vertrag nun als solcher gut oder schlecht ist.
Wie hoch muss das Entgelt für die künstlerische Leistung, an der Rechte eingeräumt werden, sein, um es als „fair“ bezeichnen zu können? Bei einem Künstler- oder Bandübernahmevertrag (vereinfacht gesagt liegt der Unterschied in der Intensität der Bindung) berechnet sich dieses Entgelt in Prozentpunkten vom Händlerabgabepreis pro verkaufter Einheit. Und: Zwischen 6% und 25% kommt einem da in der Praxis so ziemlich alles unter. Mitunter wird auch nach Erreichen der Gewinnzone (Break Even) ein anderer, höherer Prozentsatz vereinbart. Achtung: Vielfach sind für Download und Streaming andere Beteiligungen vorgesehen als für den physischen Verkauf.
Ob man nun eine bestimmte Ziffer als hoch oder niedrig, also zufriedenstellend oder nachbesserungswürdig, einstuft, hat aber immer auch damit zu tun, welche Leistung der Vertragspartner erbringt. Heute haben wir es vielfach mit der Situation zu tun, dass der oder die KünstlerIn quasi im Alleingang für ein fertiges Produkt sorgt. Urheberschaft, Produktion, Grafik/Layout, Booking, Vermarktung – alles wird DIY besorgt und man fragt sich manchmal nicht ganz zu Unrecht: Worin besteht eigentlich die Leistung des Labels?
Die besteht vielfach „nur“ noch darin, den Tonträger zu vertreiben. Das ist natürlich keine Kleinigkeit, denn Vertrieb ist ein wesentlicher Faktor, erfordert eine ausgeklügelte Logistik und viel Manpower. Aber wird der Tonträger auch beworben? Passiert also irgendeine Art von Promo? Und wurde die Produktion selbst in irgendeiner Art und Weise unterstützt? Falls das zu verneinen ist, sollte man sich als Artist die Frage stellen, ob es einen anderen Grund gibt, sich trotzdem für dieses Label zu entscheiden. Vielleicht ist es ja der klingende Name, der in bestimmten Kreisen für Zungenschnalzen sorgt und von dem man sich eine positive Verkaufswirkung verspricht. Auch das kann man als Leistung betrachten.
Oder ist nicht, ganz egal welcher Prozentsatz vertraglich zugesichert wird, ein reiner Vertrieb die bessere Lösung? Das würde dann bedeuten, dass man sein eigenes Label gründet. Wenn man ohnedies schon alle Label-Agenden selbst erledigen muss oder gar nicht in die Verlegenheit kommt, sich darüber Gedanken zu machen, weil man kein Label findet, scheint das angebracht.
Essenzieller als die Frage nach einem genauen Prozentsatz ist jedenfalls die ganzheitliche Sicht: Welcher Leistung steht eigentlich welche Gegenleistung gegenüber? Zahlt es sich wirklich aus, mit einem Label zu kooperieren?
Punkt 2: Der Rocky-Effekt
Vielfach hat man es heute in Künstler-, Bandübernahme-, aber auch Verlagsverträgen (dazu später) mit umfassenden Rechtseinräumungen zu tun. Das Schlagwort lautet: „360 Grad-Verträge“ oder „Multiple Right Deals“. Ein bisschen ist es mit diesen Verträgen wie mit Rocky in der Schwimmhalle. Konkret ist die Szene gemeint, in der Rocky sich tollpatschig im Brustschwimmen üben muss und sein Trainer zu ihm sagt: „Du wirst Muskeln spüren, von denen du nicht einmal wusstest, dass du sie hast!“ Auf diese multiplen Rechteabtretungen umgelegt heißt das: „Du wirst Rechte abtreten, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast.“
Weshalb sich Label/Verlage möglichst viele Rechte abtreten lassen, kann nun zweierlei Gründe haben: Entweder der Vertragspartner hat gar kein Interesse daran, all diese Rechte auszuwerten, sondern es geht eher darum, sich für den (größtenteils unwahrscheinlichen) Fall des überraschenden kommerziellen Erfolges eines Tonträgers abzusichern. Mit anderen Worten: Wenn der Song durch die Decke geht, will man von Label- bzw. Verlagsseite auch wirklich alles damit machen können, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen. Für den Artist bedeutet das jedoch im Gegenzug: Er gibt Rechte auf, mit denen er vielleicht mehr anzufangen weiß als das vertragliche Gegenüber.
Oder zweitens: Der Vertragspartner ist nicht nur Label, sondern verfolgt ein Business-Modell, bei dem es gerade darum geht, möglichst viele Agenden (Booking, Verlag etc.) neben dem klassischen Labelgeschäft zu übernehmen.
Vereinfacht gesagt: Wenn vom Partner auch wirklich mehrere Dinge angeboten werden, ist die Abtretung der dafür erforderlichen Rechte auch OK, weil sie der Auswertung dient. Wenn sie dagegen nur der Absicherung von Rechten im Falle künftigen Erfolgs dient, sollte man sich die Abtretung gut überlegen.
Vielfach finden sich heute auch Bestimmungen, in denen sinngemäß Rechte, die durch künftige technische Entwicklungen entstehen, abgetreten werden. Ganz abgesehen davon, ob das aus juristischer Sicht überhaupt möglich ist, bedeutet es, dass auch die Rechte an einer Verwertungsart, die es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht gab, aber während der vertraglichen Laufzeit erfunden wird, abtritt. Diese Regelungen sind Folgen des Internets. Falls es noch einmal eine so bahnbrechende und nicht vorhersehbare Neuerung geben sollte, will man nicht neuerlich verhandeln, sondern ungefragt auch in diesem Bereich auswerten können.
Problematisch sind auch Bestimmungen, mit denen man Rechte an anderen Produktionen mitüberträgt. Beispiel: Ein Artist räumt vertraglich nicht nur die Rechte an der vertragsgegenständlichen Produktion ein, sondern sichert „quasi nebenbei“ auch die Rechte aller anderen Produktionen, die während der Vertragslaufzeit entstehen, zu. Eine solche Rechtsübertragung kann so weit gehen, dass auch Produktionen, die unter anderem Namen, in anderen Formationen entstehen, der Plattenfirma angeboten werden müssen, die dann das exklusive Recht hat, dieses Recht aber nicht ausüben muss. Unterzeichnet man solche Bestimmungen, kann das im schlimmsten Fall existenzvernichtende Auswirkungen haben, weil die Kreativität „aufs Eis gelegt“ wird.
Ob man als UrheberIn/MusikerIn nun einzelne dieser Rechte „rausverhandeln“ kann, d.h. aus der Rechtsübertragung streichen kann, hängt ganz von der eigenen Marktmacht ab, mehr aber noch von der Haltung des Vertragspartners. Die alles entscheidende Frage lautet: Welches Recht oder welche Rechte braucht das Gegenüber wirklich (für die angedachte Verwertung) und was ist bloße Draufgabe?
Besonders aufpassen muss der/die UrheberIn auch, wenn er/sie zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung noch nicht Mitglied einer Verwertungsgesellschaft ist. Dann nämlich kann er/sie rein theoretisch noch über diese Verwertungsrechte verfügen. Räumt er/sie diese seinem Vertragspartner ein, fallen die Tantiemen nicht ihm/ihr, sondern dem Vertragspartner an. Schlimmer noch: „Der Vertragspartner könnte ihm/ihr sogar die Aufführung seiner/ihrer eigenen Werke untersagen. Glücklicherweise findet sich in derartigen Rechteübertragungs-Katalogen fast immer ein so genannter Verwertungsgesellschaftenvorbehalt. Das ist eine Rechtsvorschrift, die die Übertragung der (üblicherweise durch eine Verwertungsgesellschaft wie die AKM) wahrgenommenen Rechte von der Rechteübertragung ausnimmt. Für den Fall, dass ein solcher Passus fehlen sollte, ist es essenziell, diesen rein zu reklamieren. Der/Die UrheberIn kann also (für den Fall, dass er/sie diese nicht ohnedies schon der AKM eingeräumt hat) nicht über diese Rechte verfügen. Zu seinem eigenen Schutz.“
Punkt 3: Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Aus dem täglichen Leben wissen wir: Lebenslange Beziehungen funktionieren nur allzu selten. Warum also Beziehungen über den Tod hinaus schließen? Nichts anderes aber heißt die Wendung „auf Schutzfristdauer“ oder „für die Dauer der jeweils gültigen Schutzfristen“.
Zur Erklärung: Die urheberrechtliche Schutzfrist beträgt in Europa – durch eine EU-Richtlinie harmonisiert – 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Ist der Urheber eines Werkes also 30 Jahre alt und geht man davon aus, dass er noch mindestens 40 Jahre vor sich hat, ist der Vertrag damit auf 110 Jahre (!) geschlossen. Keine Kleinigkeit und in aller Regel nur dann sinnvoll, wenn man vorhat einen Hit à la „Last Christmas“ zu schreiben. Dann nämlich hat man dadurch auch das Auskommen der Kinder und Kindeskinder gesichert.

Freilich muss man zwischen Vertragsdauer und Dauer der Rechtseinräumung unterscheiden. D.h. ich kann einen Künstlervertrag etwa auf zehn Jahre (Vertragsdauer) abschließen. Und alles, was in dieser Periode geschaffen wird, kann dann „auf Schutzfristdauer“ ausgewertet werden. Vielfach findet sich in den heute kursierenden Verträgen aber unter beiden Punkten, d.h. unter Vertragsdauer und Rechtseinräumung, die Wendung „auf Schutzfristdauer“. Das heißt: Ich binde mich über meinen Tod hinaus, damit meine Werke über den Tod hinaus (entweder 70 Jahre nach Veröffentlichung beim Künstlervertrag oder sogar 70 Jahre nach Tod des letzten lebenden Urhebers beim Verlagsvertrag) verwertet werden. Absurd, aber so ist es.
Noch absurder ist die heute schon beinahe übliche Wendung „für die Dauer der jeweils gültigen Schutzfristen einschließlich Verlängerungen“. D.h. es wird auch für den Fall vorgesorgt, wenn man innerhalb der EU diese 70 einmal in 80 oder 90 Jahre abändert. Sinnvoller für beide Seiten ist es, einmal eine bestimmte Zeitdauer gemeinsamen Weges zu gehen und dann – nach Ablauf dieser Zeitspanne – zu evaluieren, ob es sich für beide Seiten rentiert hat. Eine sinnvolle Regelung etwa wäre, eine Vertragsdauer von drei und eine Auswertungsfrist von zehn Jahren zu vereinbaren. Viele seriös arbeitende Labels sehen das auch genau so vor. Der Trend im angloamerikanischen Raum geht allerdings ganz klar in Richtung längere Vertragsdauer. Lange Bindungen sind nicht von vornherein zu verurteilen. Sie machen allerdings nur dann Sinn, wenn ein/eine KünstlerIn aufgebaut wird. D.h. auch hier kommt es ganz wesentlich auf das Verhältnis Leistung-Gegenleistung an.
Punkt 4: Optionen
Unter einer Option versteht man juristisch das Recht, ein inhaltlich vorausbestimmtes Schuldverhältnis in Geltung zu setzen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. In einem Vertrag findet sich z.B. folgende Bestimmung: „Der Künstler räumt dem Lizenznehmer die zweimalige Option ein, den Vertrag für ein weiteres Jahr zu verlängern. Die Option kann schriftlich bis spätestens drei Monate vor dem Vertragsende ausgeübt werden.“
Im Klartext heißt das, der Vertragspartner hat das einseitige Recht, den Vertrag zu verlängern. Das Unangenehme daran ist: Man weiß nicht, ob die Gegenseite ihr Recht nun ausüben wird oder nicht, und man muss Fristen (hier: drei Monate) abwarten, wird also in eine passive Rolle gedrängt.
Mitunter gibt es auch mehrere solcher Optionen, die nacheinander ausgeübt werden können. Manche solcher Optionsketten sind so kompliziert formuliert, dass sich selbst Juristen nicht mehr auskennen. Besser ist, den Vertrag nach einer genau festgesetzten Dauer enden zu lassen und dann zu evaluieren. Wenn solche Optionen nicht verhandelbar sind und vor allem, wenn es eine Optionskette ist, sollte man sich unbedingt mittels einer Skizze veranschaulichen, was das im Detail bedeutet. Wie lange kann der Vertrag maximal dauern, wenn alle Optionen am letzten Tag der Frist ausgeübt werden? Wie lange dauert er, wenn keine Option ausgeübt wird? Und was bedeutet das im Detail?
Punkt 5: Der Verlagsvertrag: Wo war meine Leistung?
Technisch gesehen ist es so: Ein Musikverlag ist ein gewerblich tätiger Verwerter von Werken der Musik. Er agiert als Mittler zwischen der Industrie und dem/der AutorIn, versucht seinen Klienten bei kommerziellen Nutzern (Film, Fernsehen, Werbung etc.) unterzubringen, agiert daher generell als Dienstleister, teilweise sogar als Manager eines/einer Künstlers/Künstlerin.
In der Praxis aber fängt es oft anders an: Wer sich nach Auswertungsmöglichkeiten einer Tonaufnahme fragt, wer sich fragt, wer wie viel daran verdient, wenn ein Musikstück im Radio gespielt wird, wer sich fragt, wie eine Musik zum Regisseur oder dem Soundtrack-Verantwortlichen kommt, befindet sich eigentlich schon mitten im Verlagsgeschäft. Ob es dann der/die KünstlerIn selbst ist, der/die diese Agenden in die Hand nimmt, ein Label oder eben ein Verlag – die Grenzen verschwimmen zusehends. Aber ab wann braucht man einen Musikverlag? Ab wann also ist der Abschluss eines Musikverlagsvertrages sinnvoll?
Der Musikverlag lässt sich von AutorInnen Verlagsrechte meist weltweit zusichern. Dafür ist es sinnvoll, einen Subverlag in bestimmten Regionen der Welt zu haben. Eigentlich sind Verwertungsgesellschaften zwar ohnehin weltweit vernetzt, die Datenmengen sind aber so umfassend, dass niemals alle KünstlerInnen der Welt erreicht werden können. Der Subverlagspartner, der sich im jeweiligen Land auskennt, kann gezielter Werke vermitteln, aufbereiten und vor allem Tantiemenabrechnungen überprüfen. Vereinfachend kann man sagen: Je umtriebiger, je internationaler bzw. international vermarktbarer ein musikalisches Projekt ist, desto interessanter wird ein Verlagsvertrag, desto sinnvoller ist es, einen Verlagsvertrag mit einem international agierenden Verlag abzuschließen.
Vorsichtig sollte man sein, wenn Plattenverträge automatisch an einen Verlagsvertrag gekoppelt sind. Nicht jede Plattenfirma kann auch ein guter Verlag sein. Oft ist es der Wunsch, an den Tantiemen des/der Künstlers/Künstlerin beteiligt zu werden, der hier der Vater des Gedankens ist. Eine solche Beteiligung (im Zweifel 40% nach dem Verteilungsschlüssel der Verwertungsgesellschaften) ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Verlag auch eine Gegenleistung erbringt, d.h. wenn er sich aktiv um die Verwertung der Autorenrechte kümmert.
Der Artist muss sich überlegen, ob der Verlag tatsächlich Kontakte hat und diese auch aktiv für ihn bearbeiten wird, denn es gibt aktive, aber auch passive Verlage, d.h. solche, die sich aktiv darum kümmern, dass das Werk in alle nur erdenklichen Verwertungskanäle eingespeist wird, aber auch andere, die überwiegend nur reagieren.
Vor Abschluss sollte man sich daher unbedingt veranschaulichen:
Welche Beziehung habe ich zum Verleger? Ist sie vertrauensvoll? Traue ich ihm zu, dass er sich für mich entsprechend einsetzt, mich also im Radio, Fernsehen, in Kinofilmen, der Werbung, Computergames etc. unterbringen wird? Wird er für mich rotieren, damit ich im Radio rotiere? Wird er nichts unversucht lassen und sei es, mich für Telefonschleifen oder die Geräuschkulisse auf der Flughafentoilette zu empfehlen?
Das mag Vertrauenssache sein, darüber hinaus lässt sich aber auch recherchieren, welche Referenzen der Verlag vorzuweisen hat, welchen Ruf er in entsprechenden Kreisen genießt, bzw. was er für andere, vergleichbare KünstlerInnen schon getan, welche alternativen Verwertungskanäle er für sie erschlossen hat. Ergibt sich da ein seriöses Bild mit konstruktivem Plan oder geht es dem Verlag eher darum, am Tantiemenrückfluss beteiligt zu werden und sich somit eine zusätzliche Einnahmequelle zu erschließen?
Auch der Verlagsvertrag sollte nicht „auf Schutzfristdauer“ abgeschlossen werden, sondern auf einige Jahre befristet, um nach Fristablauf zu evaluieren, ob der Verlag mehr rein gebracht hat, als er an Tantiemen abgeschöpft hat.
Vorsicht ist in jedem Fall vor versteckten Bestimmungen in Künstler- bzw. Bandübernahmeverträgen geboten! Wurde nie über die Abtretung von Verlagsrechten gesprochen, ist ein versteckter Passus über die Abtretung solcher Rechte meist ein überdeutlicher Hinweis auf die mangelnde Seriosität des Vertragspartners.
Mitunter kann eine Abtretung von Verlagsrechten aber geboten sein, um die Veröffentlichung eines Tonträgers überhaupt zu ermöglichen. Das ist vor allem im Klein- und Kleinstlabelbereich möglich. In einem solchen Fall braucht das Label den prozentuellen Anteil am Tantiemenrückfluss, um überhaupt in die Gewinnzone zu kommen, d.h. die Produktion überhaupt finanzieren zu können. Das heißt: Ein kleines Label ermöglicht mir den Start ins Business. Um die Pressung von einer Kleinauflage Vinyl überhaupt finanzieren zu können, ist das Label auf genau diesen Tantiemenrückfluss angewiesen. D.h. die Abtretung von Verlagsrechten ist „Part of the Deal“, damit das Erscheinen des Tonträgers überhaupt finanzierbar ist.
In der Praxis kommt es leider auch vor, dass Bands dazu angehalten werden einen Verlagsvertrag abzuschließen, weil sonst keine Promotion in die Wege geleitet wird. Keine Promo ohne Verlagsrechte also. Als Artist sollte man solche, an Erpressung grenzenden Vereinbarungen meiden wie der Teufel das Weihwasser.
Bei Unklarheiten kann man sich an die FachreferentInnen des mica – music austria wenden. Die Beratung ist kostenlos.
Markus Deisenberger
Danke
Dieser Beitrag wurde von der Kulturabteilung der Stadt Wien (MA 7) gefördert.