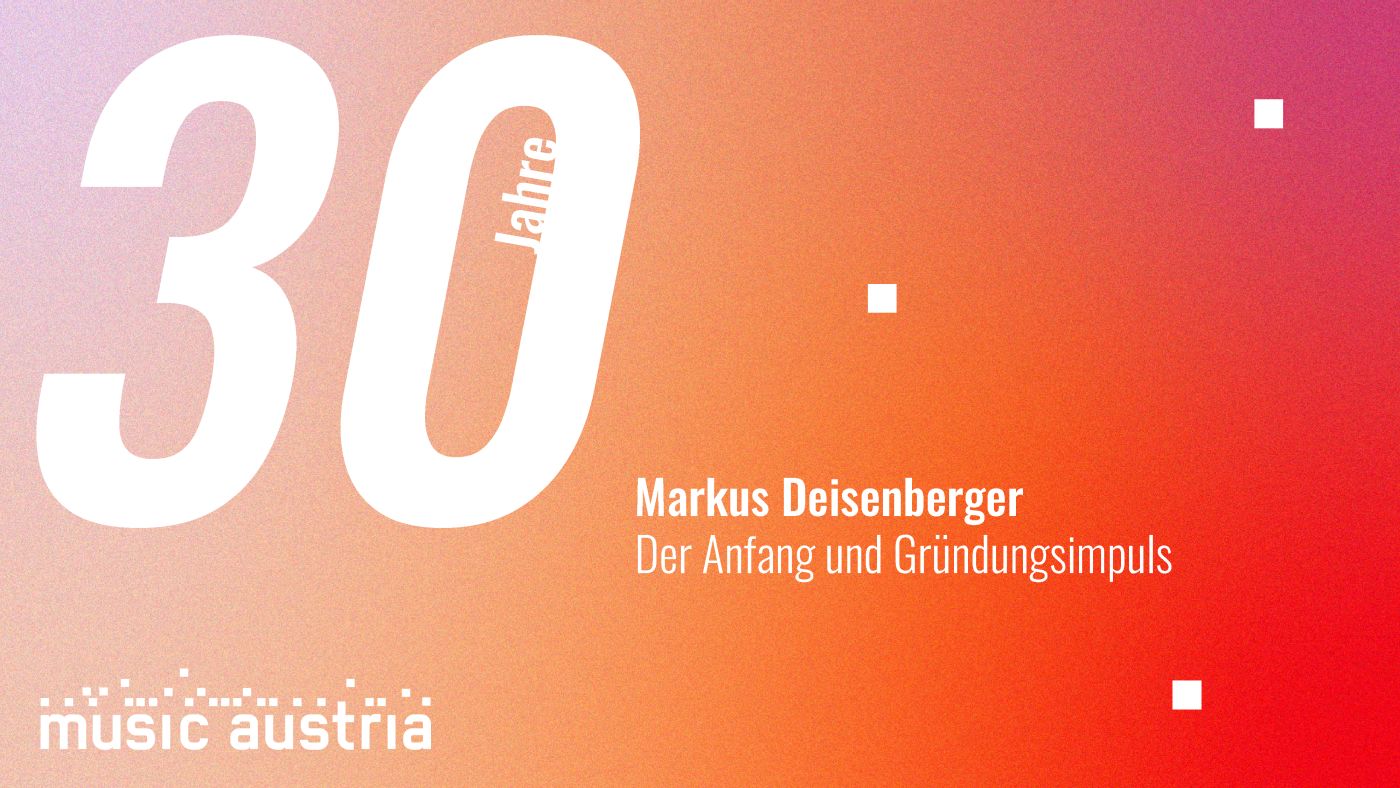Anlässlich des 30-jährigen Bestehens von mica – music austria blickt Markus Deisenberger auf die Anfänge des österreichischen Musikinformationszentrums zurück. Gesprächspartner im ersten Teil ist der Künstlerische Leiter von Wien Modern, Bernhard Günther, der einst als Herausgeber mit einem Lexikon den Grundstein für die Musikdatenbank von mica – music austria legte. Der zweite Teil spannt den Bogen von den visionären Anfängen über die Entwicklung der Redaktion und der digitalen Projekte bis zum Status quo der Online-Angebote.
Einen nicht unbedeutenden Anteil der Arbeit von mica – music austria machen Betrieb und Pflege der Musikdatenbank aus, der heute international wichtigsten Informationsquelle zu zeitgenössischer österreichischer Musik. Dass der Ursprung dieser hochfrequentierten digitalen Quelle auf ein Buch zurückgeht – das von Bernhard Günther 1997 herausgegebene „Lexikon zeitgenössischer Musik aus Österreich“ –, wissen heute allerdings nur noch die wenigsten.
Günther, heute künstlerischer Leiter des Festivals Wien Modern, von 1994 bis 2004 für mica – music austria als Kurator für neue Musik, später auch im Bereich digitale Medien und Urheberrecht sowie zuletzt auch als stellvertretender Geschäftsführer tätig, erinnert sich an die Legung dieses Grundsteins: „Putting Austria on the Map!“ war das Ziel der frühen Jahre, erzählt er. Was heute selbstverständlich klingt, nämlich dass Österreich in der zeitgenössischen Musik auf der musikalischen Landkarte sichtbar ist, war in der Frühphase des mica Mitte der 1990er Jahre keineswegs der Fall. Es war anlässlich eines vom mica mit vorbereiteten Österreich-Schwerpunktes 1994 bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik, erzählt Günther, als Christian Ofenbauer versuchte, deutschen Kompositionskolleg:innen den Besuch eines Österreich-Abends schmackhaft zu machen. Die Reaktionen waren verhalten bis ablehnend. „Ach, die Ösis, die bringen doch nichts zusammen …“, hieß es damals.
Heute ist das angesichts der Breite und Dichte qualitativ hervorragender und international erfolgreicher zeitgenössischer Musik aus Österreich nur noch schwer vorstellbar. Damals nahm man den reparaturbedürftigen Befund im mica zum Anlass, „alle möglichen Schritte zu setzen, um das Image zu ändern und die Wahrnehmung zu unterstützen“, erzählt Günther. „Wir haben Präsenz auf Festivals gezeigt, viel Promotion gemacht, weil viele Komponist:innen damals nicht verlegt waren. Wir haben uns insgesamt darum gekümmert, dass auf möglichst vielen Kanälen die Präsenz österreichischer Musik steigt.“ Der damalige Musikwissenschaftsstudent fuhr jährlich nach Witten und Donaueschingen und ging dort mit einem Bauchladen herum: „Ich verteilte CDs, Prospekte und Noten, suchte das Gespräch mit Veranstalter:innen und Journalist:innen.“

„Machen wir doch ein Buch, in dem alle Komponist:innen drin stehen“
Und als eine der ersten Maßnahmen bei der Gründung des mica war ein Lexikon angedacht. „Machen wir doch ein Buch, in dem alle Komponist:innen drin stehen“, so die Ursprungsidee. Klar war dabei das Ziel des angedachten Buches: „Zeigen, was es gibt.“ Und es sollte unbedingt überparteilich sein, also keinem der damaligen ästhetischen Lager zugehörig erscheinen. Wie groß das Projekt, wie umfangreich dieses Buch allerdings werden würde, war anfangs völlig unklar und Gegenstand einer längeren Projektentwicklung. In einem ersten Schritt wurde schließlich ein Katalog von zehn objektiven Kriterien entwickelt, etwa dass Werke regelmäßig in Österreich oder international aufgeführt werden, dass sie verlegt werden, auf Tonträger erschienen sind etc. und man einigte sich darauf, dass vier dieser zehn Kriterien erfüllt sein mussten, um ins Lexikon aufgenommen zu werden. „So wurden es dann 424 Leute und 1.268 Seiten. Das wussten wir vorher nicht …“, lacht Günther heute.
Konzeption und Fertigstellung schließlich nahmen gut drei Jahre in Anspruch. „Wir haben klein angefangen, aber nicht bei Null. Diverse Vorläuferprojekte seit den 1970er Jahren waren im Sande verlaufen. Es gab eine elektronische Datensammlung, die irgendwann im Auftrag des damaligen ÖKB (heute ACOM) von Peter Oswald begonnen und dann von der Musikwissenschaftlerin Margareta Saary weitergeführt und schließlich ans mica verkauft wurde. Von Anfang an war das Musiklexikon also auch ein digitales Projekt: Eine auf Microsoft-Basis von Sascha Otto maßgeschneiderte Datenbank wurde installiert und laufend angepasst, erinnert sich Günther: „Wir waren überzeugt, dass es genau diesen hybriden Zugang brauchte – Buch und Datenbank. Wir haben auf die spätere Nutzbarkeit im Internet von Anfang an Wert gelegt, auch wenn es nach dem Buch noch einmal rund zwei Jahre dauern sollte, bis Online-Datenbankabfragen wirklich funktionierten.“ Aus heutiger Sicht und mit Blick auf die Nachnutzung war das damals visionär, denn 1994 – Festplatten mit 540 MB und piepsende Modems mit 28,8 KB pro Sekunde waren State of the Art, und nur die allerneuesten Handys konnten bereits SMS – war noch lange nicht klar, wie wichtig und zentral das Digitale einmal werden würde.
Ab dem Herbst 1994 hat das Projekt rasch an Momentum gewonnen. In der heißen Phase, blickt er zurück, „haben über 20 Leute daran gearbeitet, und zwar tendenziell rund um die Uhr.“ Hunderte Nachtschichten waren letztlich nötig, um das Projekt voranzutreiben. Denn die Beschaffung der Daten lief weitgehend analog – und war pure Knochenarbeit: Ein Großteil der Informationen wurde tatsächlich per Post eingeholt. Es wurden hunderte von Rundschreiben – das waren „dicke Packen mit Fragebögen“ – an recherchierte Adressen geschickt. „Wir forderten Werklisten mit vielen Details an, fragten, wo Aufnahmen liegen, in welchem Archiv etc. Ein Gutteil der Arbeit bestand dann darin, nachzuwassern. Das Team hat monatelang nachgeschrieben und nachtelefoniert. Ich habe mich mit vielen Komponist:innen und teilweise Nachlassverwalter:innen getroffen, um ihnen die Informationen liebevoll aus der Nase zu ziehen“, so Günther. Werner Pirchner schulde ihm bis heute ein Achterl, weil der (leider inzwischen verstorbene) Komponist anfangs gar nicht wollte, sich dann aber überreden ließ, mit dem Ergebnis letzten Endes sehr zufrieden war und Spaß an der Sache fand.
Und die Musikwelt hat sich weitergedreht
Bis die Daten ins digitale Format der Datenbank eingearbeitet waren, hat es jedoch lange gedauert. Zu lange. In der Zwischenzeit hatte sich schon wieder das eine oder andere geändert. Nachdem den Komponist:innen die Ausdrucke ihrer Einträge zugeschickt worden waren, kamen daher viele Ergänzungen zurück. „Die Musikwissenschaftler:innen im Team, allen voran Andreas Vejvar und Günther Leucht, haben akribisch korrigiert, vereinheitlicht, nachrecherchiert, ergänzt und nachgefragt. Yasmin Kiss als Bildredakteurin schickte den Fotografen Sepp Dreissinger zu Fototerminen mit einigen Komponist:innen, von denen es kein brauchbares Bildmaterial gab. Walter Bohatsch und Martha Stutteregger sorgten für Perfektionismus bei Grafik, Satz und Typografie. Es gab endlose Korrekturen.“ Trotzdem lag das Werk Ende 1997 endlich gedruckt vor und sorgte in der Fachwelt sofort für jede Menge Aufsehen. In der Opernwelt wurde es zu einem der besten Bücher des Jahres gewählt, auf der Frankfurter Buchmesse war es als eines der schönsten Bücher des Jahres ausgestellt, und als neues Standardwerk landete es schnell in den Arbeitszimmern vieler Profis im Musikbereich. „Das Buch war ein großes Ausrufezeichen!“, ist Bernhard Günther immer noch stolz, war doch der Erfolg auch alles andere als selbstverständlich. „Das mica hat 1994 mit einem kleinen Team angefangen, das aus der Hilfe zur Selbsthilfe in der freien Musikszene kam und sich immer mehr in Richtung professioneller Hilfestellung entwickelt hat.“ Wenn Günther zurückdenkt, ist er heilfroh, „dass wir das Datenformat damals mitgedacht haben“, weil nach dem einmaligen Ausrufezeichen die kontinuierlich und aktuell verfügbare Online-Datenbank genau das sei, was es heute braucht.
Und die Musikwelt hat sich weitergedreht. „Heute haben wir wahnsinnig gute Komponist:innen in Österreich, die national und international erfolgreich sind. Neuwirth, Haas, Lang, Ivičević, Kranebitter und viele, viele andere. Die Szene ist sehr lebendig, und das kriegt man auch mitspüren inzwischen auch viele.“ Das sei aber alles andere als ein Selbstläufer, von daher sei es wichtig, dass es eine Stelle gibt, die sich professionell darum kümmert, dass Musik ständig aktuell und professionell dokumentiert ist und die Informationen um die Welt gehen. „Das macht echt einen Unterschied“, so Günther. Manche Musiker:innen hatten, als sie noch kaum jemand kannte, in den Räumlichkeiten von mica – music austria ihre ersten Gigs. Günther fällt spontan Patricia Kopatchinskaja ein, die in den 1990er Jahren als Studentin im damaligen Seminarraum des mica ein gut besuchtes Konzert gab, vor etwa vierzig Besucher:innen. Heute ist sie ein Weltstar.
Was hat beim Projekt Musiklexikon den Unterschied gemacht? „Geduld. Heute wäre es viel schwerer, nach zwei Jahren Arbeit an einem mehr oder weniger ergebnisoffen gestarteten Projekt spontan noch ein drittes Jahr dranhängen zu dürfen, damit das Resultat wirklich perfekt wird. Die Geduld damals hat Früchte getragen.“

Eigene Strukturen erfinden
Viel geschah in den Anfangstagen des mica aus dem Gründungsimpuls heraus, erzählt Bernhard Günther. In einem Monsterunterfangen wagten die Bundeskuratoren Lothar Knessl und Christian Scheib, auf die auch die Initialzündung für das Lexikon zurückging, gemeinsam mit der damaligen ersten mica-Geschäftsführung Matthias Finkentey die Übersiedlung von der Spengergasse im fünften Bezirk in eine zu renovierende Liegenschaft im siebenten Wiener Gemeindebezirk am Spittelberg, von wo aus das mica – heute zu „mica – music austria“ erweitert – „bis heute seine segensreiche Wirkung ausstrahlt“, wie es Christian Scheib in einem Text zur Würdigung von Lothar Knessls Lebenswerk beschrieb. Knessl, über Jahrzehnte hinweg der Doyen der zeitgenössischen Musikszene, und Scheib verbrachten in den 1990er Jahren viel Zeit miteinander, „auch viel öffentliche Zeit in unserer Funktion als die zwei Musik-Kuratoren des Bundes’“, erinnert sich Scheib, eingesetzt von Rudolf Scholten, damals Minister für Unterricht und Kunst. „Im Gegensatz zu anderen ministeriellen Kuratoren waren wir dezidiert gemeinsam mit dieser Aufgabe betraut worden. Das führte zur Gründung des mica, also des Musikinformationszentrums, zur Neuausstattung des Klangforum Wien und zur Gründung des aufwändigen Schulprojekts „Klangnetze“.
Scheib blieb dem mica lange als Vorstand verbunden, ebenso Lothar Knessl, der seine „scouthafte Suche nach dem noch Unbekannten, dem Jungen, dem Qualitätsvollen“ – wie es Scheib in seinem Nachruf so schön formulierte – nie aufgab, sondern auf seinen Reisen zum Warschauer Herbst, zum musikprotokoll nach Graz und immer wieder nach Donaueschingen genau das tat, was im Grunde genommen auch heute noch eine der Kernaufgaben von mica – music austria ist: Netzwerke bilden und nutzen, um neue Hörerschichten für österreichische Musik zu begeistern.
Markus Deisenberger
Links:
Musikdatenbank
Wien Modern
Lothar Knessl. Eine Erinnerung aus mica-Perspektive – eine Würdigung von Christian Scheib.